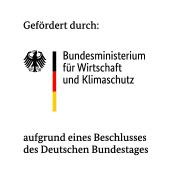Wer kennt es nicht: Die Gartenmöbel, die im Frühling frisch gestrichen noch im satten Braun glänzten, wirken schon nach wenigen Sommern stumpf, spröde und rissig. Die einst glatte Lackschicht beginnt sich abzulösen. Schuld daran sind Verwitterungsprozesse: Feuchtigkeit durch Regen, Schnee und Tau setzt den Oberflächen ebenso zu wie die Sonnenstrahlung. Speziell der ultraviolette (UV) Anteil im Spektrum der Sonne zersetzt im Lauf der Zeit die chemischen Bindungen im Lack, ein Prozess, der als Photodegradation bezeichnet wird.

Doch was genau passiert dabei auf molekularer Ebene? Und wie kann man Lacke entwickeln, die länger halten und Witterungseinflüssen besser trotzen? Diesen Fragen widmete sich ein Forschungsprojekt mit Beteiligung des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS. Weitere Projektpartner im Rahmen der CORNET (Collective Research Networking)-Initiative, einem internationalen Netzwerk von Förderorganisationen für Forschungsprojekte zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen waren das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie die belgischen Forschungseinrichtungen Materia Nova A.S.B.L. und Belgian Building Research Institute. Gemeinsam gingen sie den Mechanismen der Photodegradation in Lacken auf den Grund – und untersuchten, inwieweit man Lacksysteme durch den Einsatz von UV-Schutzpartikeln deutlich widerstandsfähiger machen kann.